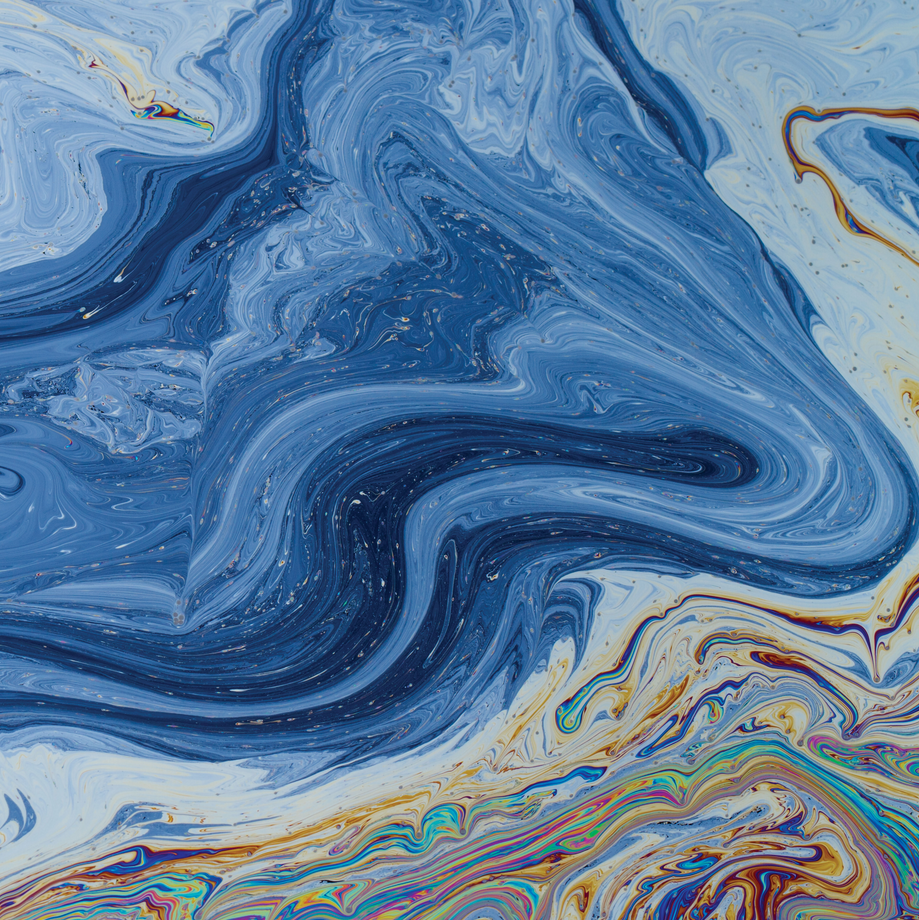
Foto-© Dan Medhurst
London, 2019: Über den nächtlichen Himmel eines Drum & Bass-Beats, der aus einem der verbliebenen Clubs schallen könnte, ziehen dünne Klangwolken eines Buchla-Synthesizers. Einzelne Soundschnipsel leuchten auf und verglühen dann rasch wieder. Dieselbe Maschine steht am Boden und spuckt industrielle Klänge aus, die sich erst lustvoll um den treibenden Rhythmus winden und ihn dann niederstampfen: Crush.
Das Zweitwerk von Sam Shepherd alias Floating Points ließ lange auf sich warten. Bereits 2015 hatte der junge Brite nach hochgelobten EPs und Singles 2015 mit seinem Debüt Elaenia für Aufregung gesorgt. Darauf vermischte er House-Elemente, Improvisation und zeitgenössische Klassik, bis das Fender Rhodes durch elegische Streicherarrangements glitt und die vielbeschworenen Weiten des Jazz-Kosmos ergründete. Ein Album, das den Besuch von Club und Konzertsaal in eine einzige, kühle Sommernacht zusammenfasste.
Doch auch die Londoner Sommer sind heißer geworden. Und das Album, das dort in nur fünf Wochen konzentrierter Produktion den letzten Schliff erhielt, erzählt von diesen Veränderungen. Schon der Opener Falaise kündigt an: die wohligen Streicher, mit denen Shepherd zeitweise im sechzehnköpfigen Floating Points Ensemble unterwegs war, haben Federn gelassen. Noch huschen sie verspielt umher, bevor er sie mitsamt Bläsersätzen zu einem zerbrechlichen Crescendo schichtet, dessen Nachhall einen großen Raum für neue Experimente hinterlässt.
Ob Last Bloom oder die Leadsingle Anasickmodular, Floating Points setzt dabei vermehrt auf das weite Klangspektrum des Buchla-Synthesizers. Vorangetrieben werden diese Tüfteleien nun stets vom treibenden Fundament der Kickdrum, sodass sie sich vorerst nicht in sich selbst verlieren. Unverkennbar bleiben dabei die melancholischen Flächen, mit denen er in Requiem for CS70 and Strings kurz das Tempo herunterfährt, nur um in LesAlpx klarzustellen: die beseelten Improvisationen des Vorgängers sind harscher Elektronik gewichen; der urbane Moloch gewährt keinen Rückzugsraum mehr. So fremd sehen die gewohnten Formen in der fieberhaften Mittagshitze von Bias aus, dass sich Songs wie Environments als großer Abgesang verstehen lassen. Über einem nervösen Beat verklären sich die wehmütigen Klänge zu heulenden Sirenen – Alarmstimmung, vollautomatisiert. Es bleibt unklar auf Crush, ob das System schon zusammengebrochen ist oder noch am Abgrund taumelt.
Bisweilen erinnert diese Gratwanderung an eine dystopische Neuauflage von Mother Earth’s Plantasia, einer kürzlich wiederveröffentlichten Obskurität aus dem Kanada der 1970er Jahre. Mit seiner auf dem Moog-Synthesizer komponierten Musik für heranwachsende Pflanzen beglückte der – wie Shepherd – klassisch ausgebildete Mort Gason damals freigeistige KleingärtnerInnen. Doch Floating Points verbietet den Rückzug in den eigenen Blumentopf: zu weit reichen immer noch die musikalischen Einflüsse, zu dringend rückt die Welt da draußen näher. Wer da bei Birth nochmal Hoffnung schöpfte, wird mit dem unzulänglichen, unvermittelt abbrechenden Apoptose – dem biologischen Fachbegriff für den vorprogrammierten Selbsttod von Zellen – eines Besseren belehrt.
Mit Crush schöpft Floating Points abermals aus all seinen Leidenschaften: zunächst als Soundtüftler und klanglicher Grenzgänger auf dem Pfad eines Aphex Twin, immer mit einem Ohr für Raritäten (wie er sie auf seiner diesjährigen Late Nights Tales-Compilation versammelte) und schlussendlich als DJ, der all das zusammenzieht und zu treibenden Clubsounds verdichtet. Die Leistung, den Irrsinn des Untergangs gleichzeitig auf so viele musikalische Punkte zu bringen, macht Floating Points damit zweifellos zu einem großen, zeitgenössischen Produzenten.

Floating Points – Crush
VÖ: 18. Oktober 2019, Ninja Tune
www.floatingpoints.co.uk
www.facebook.com/floatingpoints













